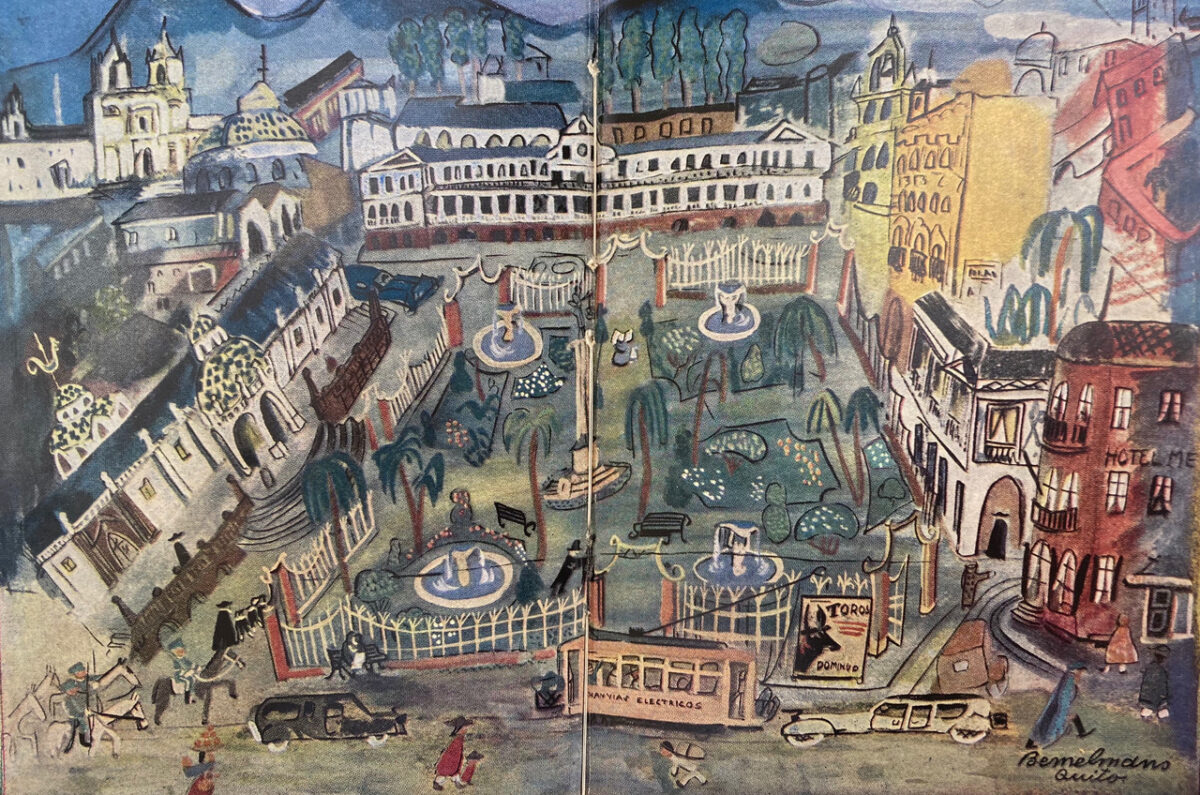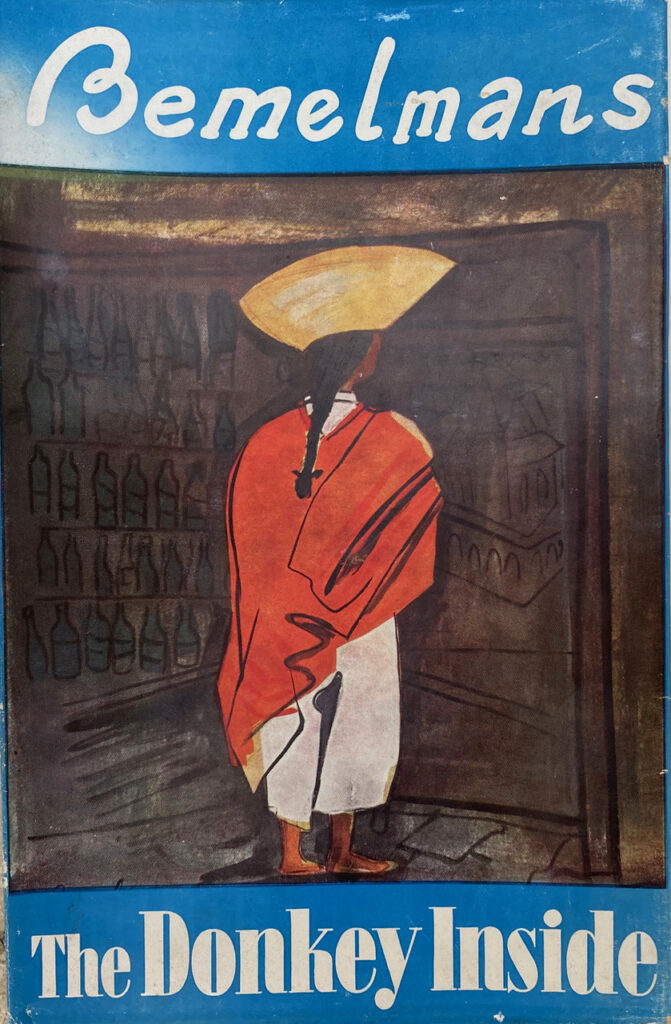Es waren Baggerführer, die die Reste der rund 5000 Jahre alten Siedlung entdeckten. Beim Bau einer neuen Straße zwischen Valdivia und San Pedro stießen sie im Jahr 1957 auf zahlreiche Tonscherben. Nur ein Jahr zuvor hatte der Archäologe Emilio Estrada wenige Kilometer entfernt, an der ecuadorianischen Pazifikküste, erste Spuren derselben, heute unter dem Namen „Valdivia“ bekannten Kultur gefunden. Keine großen Tempel, keine Königsgräber – aber riesige Mengen an Gefäßscherben sowie unzählige kleinere und größere Figuren aus Ton und Stein. Heute wird von Fachleuten vermutet, dass es sich bei der Valdivia-Kultur um die älteste des amerikanischen Kontinents handelt.
Was auf diese Entdeckung folgte, charakterisiert der Altertumswissenschaftler Karl Dieter Gartelmann als für Ecuador typische „Wochenendarchäologie“: Jeder, der wollte, kam nun nach Valdivia, sah und grub, wann und soviel es ihm seine Zeit erlaubte. Im besseren Fall erfassten diese Hobbyarchäologen gewissenhaft alle Fundstücke, bewahrten sie in ihrer privaten Sammlung auf, machten sie vielleicht sogar Dritten zugänglich. Im schlechteren boten die Kinder der umliegenden Dörfer interessierten Strandtouristen ihre Fundstücke mit den Worten, „Möchten Sie auch ein Püppchen?“ zum Verkauf an.
Kulturerhalt zwecks Schaffung einer nationalen Identität
Vor dem Hintergrund dieser und ähnlicher Erfahrungen wird auch in Ecuador immer mehr vom Schutz des Kulturerbes gesprochen. Die unter dem Präsidenten Rafael Correa 2016 erlassene Ley Orgánica de Cultura, sozusagen das „Kulturgrundgesetz“ des Landes, versteht darunter Kulturgüter, die „aufgrund ihrer historischen oder künstlerischen Bedeutung…eine soziale Funktion erfüllen…und als kollektive Gedächtnisstütze bei der Schaffung und Stärkung unserer nationalen Identität dienen“. Eine sehr weite Definition. Welches aber ist die nationale Identität, die hier geschaffen und gestärkt werden soll? Welches sind die historischen Ereignisse, und welches die Kunstwerke, auf die man sich gemeinsam als Staatsvolk beziehen möchte? In einem Land, dessen Geschichte die wirtschaftliche Elite ganz anders erzählen würde als jene über sechzig Prozent der Bevölkerung, die keiner vertraglich geregelten Arbeit nachgehen? Und wo die bedingungslose Hingabe an die Familie, die Begeisterung über die Schönheit der einheimischen Natur und die Liebe zum hiesigen Essen vielleicht der einzige gemeinsame Nenner sind, auf den sich die Gesellschaft einigen könnte?
Wie viele früher von Kolonialmächten beherrschte Staaten hat Ecuador ein gebrochenes Verhältnis zu seiner Geschichte. Die Auseinandersetzung darüber, wer hier die Geschichtsbücher schreibt, hat sich zwar längst von der internationalen Ebene in die eigene Gesellschaft verlagert. Unstrittig ist glücklicherweise auch seit langem, dass zahlreiche Werke der präkolumbianischen Kunst ebenso einen „außergewöhnlichen universellen Wert“ (so die Definition der UNESCO-Konvention zum Schutz des kulturellen Erbes von 1972) besitzen, wie die von europäischen Vorbildern und Lehrern beeinflussten Gemälde und Skulpturen der „Schule von Quito“ des 17. und 18. Jahrhunderts. Aber der Regierung Rafael Correas ging es in ihrem Gesetz weniger um die Bewahrung von Zeugnissen der Vergangenheit um ihrer selbst willen, sondern ausdrücklich um die Zukunft, um die Schaffung von nationaler Identität.
Alles bewahren, um nichts zu verlieren – Anspruch und Wirklichkeit
Und so entschied man sich dafür, prophylaktisch alles unter staatlichen Schutz zu stellen, was vielleicht einmal als „kollektive Gedächtnisstütze“ dienen könnte. Gemäß dem Gesetz von 2016 sind archäologische Fundstücke automatisch Eigentum des Staates. Jedes Kunstwerk oder Gemälde, welches der gesetzlichen Definition von „Kulturerbe“ entspricht, jedes Dokument, das älter als 50 Jahre alt ist, darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung des „Instituto Nacional de Patrimonio Cultural“ INPC verkauft, vererbt, im Ausland ausgestellt werden. Der Staat erklärt sich damit zum Stifter und Hüter kultureller Identität – aber kann er dieser Rolle auch gerecht werden? Viele Kunsthistoriker im Land zweifeln daran, und erzählen Geschichten wie diese:
In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts befand sich in der öffentlich verwalteten Casa de la Cultura in Guayaquil eine einzigartige Goldsammlung aus der Zeit der Inka. Schmuckstücke, eine wertvolle Totenmaske. Im Zuge der notwendigen Neugestaltung der Museumsvitrinen sei dieser Schatz eine Zeitlang schlichtweg im Büroschrank der Kuratorin in einem der oberen Stockwerke aufbewahrt worden. Ein Vorgehen, dass niemanden überrascht, der länger in Ecuador lebt. Eines Tages sei ein Brand just in diesem Büro ausgebrochen, und als man die zu einem traurigen Goldklumpen zusammengeschmolzene Sammlung später gewogen habe, sei sie um zwei Kilogramm leichter gewesen als früher. Im Zuge der polizeilichen Untersuchung des Vorfalls habe sich dann herausgestellt, dass der Pförtner des Gebäudes ein lukratives Geschäft mit dem Verkauf von Gold an einen ihm bekannten Zahnarzt betrieb, das er durch die Brandstiftung habe vertuschen wollen.
Solche „Anekdoten“ werden in Ecuador zuhauf kolportiert. Es wird von zahllosen Kunstwerken gemunkelt, die sich seit Jahren ungeordnet und ungeschützt in den Magazinen des Hauptsitzes der Casa de la Cultura in Quito befinden. In den historischen Archiven des Landes sieht die Realität trübe aus: Allerorten begegnet der Historiker wild durcheinanderliegenden, teils zerrissenen oder geknickten Dokumenten. Bindungen, die beim Berühren zerfallen, alte Partituren, die immer wieder von Forschenden direkt vor Ort mit der eigenen Kamera abfotografiert werden. Stapel von Akten, die zum Schutz vor dem Smog der Innenstadt schlichtweg in Plastiktüten aufbewahrt werden, den Insekten zur Freude. Nicht zu reden von jenen Dokumenten, die, nun ja, irgendwann einfach nicht mehr aufzufinden sind. Bei der Digitalisierung ihrer Bestände, die zum Schutz der Originale beitragen würde, stehen viele Bibliotheken und insbesondere das Nationalarchiv erst am Anfang. Es fehlen die Mittel, es fehlt die Ausbildung, es fehlt das Personal.
Was wollen wir vergessen, was sollen wir erinnern?
Fehlt vielleicht manchmal auch die Identifizierung mit dem, was da zu bewahren wäre? Dem Komponisten Luis Humberto Salgado, der als erster Ecuadorianer umfangreiche symphonische Werke schrieb, wurde und wird zuweilen vorgeworfen, er habe nicht nur zu kompliziert, sondern auch zu europäisch, zu „kolonial“ geschrieben. Von einem hiesigen Musikwissenschaftler wird dies als ein Grund dafür gesehen, dass sich die staatliche ecuadorianische Kulturpolitik mit der Anerkennung und Verbreitung von Salgados Werken bis heute schwer tut. Welches ist die Geschichte, deren Zeugnisse es zu bewahren gilt, und wofür? „Bei der Fortbildung junger Museumsmitarbeiter merke ich immer wieder, dass sie meinen, zwischen zwei Geschichten wählen zu müssen“, kommentiert ein Historiker. „Früher galt all das als gut und nachahmenswert, was uns die Spanier hinterlassen haben, und unsere eigene Kultur war nicht von Bedeutung. Heute möchten manche am liebsten alles vergessen machen, was zwischen der Ankunft Francisco Pizarros 1531 und der Schlacht am Pichincha 1822 geschehen ist.“
Die Begegnung einer Bevölkerung mit der eigenen Kunst- und Kulturgeschichte setzt voraus, dass deren Zeugnisse auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. „Wenn wir unsere Kulturgüter bewahren, ist das doch kein Selbstzweck! Es geht darum, dass unsere Bevölkerung sie sehen, sich mit ihnen auseinandersetzen kann!“, erklärt derselbe Interviewpartner enthusiastisch den Sinn seiner Arbeit. Aber genau hier stößt der ecuadorianische Staat an seine Grenzen. Zum einen gelingt es ihm nicht, das zu schützen und angemessen auszustellen, was sich bereits in seinem Besitz befindet. Zugleich droht er den privaten Sammlern mit der Quasi-Verstaatlichung ihrer Kollektionen und hindert sie damit effektiv, diese ihrerseits einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Die Schaffung eines kollektiven kulturhistorischen Gedächtnisses, die das erklärte Ziel der „Ley orgánica“ war, wird dadurch unmöglich gemacht.
Der Staat kann nicht effektiv schützen, die privaten Sammler dürfen es eigentlich nicht
Die eindrucksvollste Sammlung von Valdivia-Skulpturen findet sich heute im privat betriebenen Museo del Alabado direkt neben der Kirche von San Francisco in Quito. Wer das eine oder andere Haus von Angehörigen der wirtschaftlichen und intellektuellen Elite des Landes besucht, kann seine Kenntnis dieser Kultur noch beträchtlich erweitern. In dem von Ehrenamtlichen betreuten kleinen Museum von Valdivia jedoch bleibt es bei der gut gemeinten Aufforderung: „Bitte nichts anfassen!“
21. Februar 2023