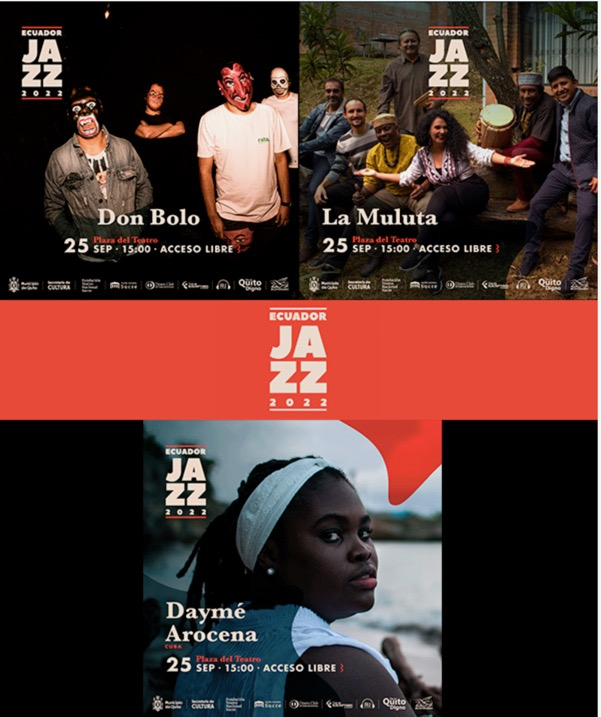„Déle nomás, déle! Weiter!“ Energisch winkt Edison Caiza (Name geändert) einen weißen Geländewagen aus der Parklücke. „Fahren Sie ruhig, da kommt keiner! Und noch ein bisschen. Jetzt das Lenkrad einschlagen!“ Die zierliche Besitzerin des großen Autos tut, wie ihr geheißen. Reicht eine Münze aus dem Autofenster, erhält ein Lächeln und ein „Danke, Gott segne Sie“. Und fährt davon. Edison steht derweil schon an der Kasse des Obst- und Gemüsegeschäfts, der „Frutería“, vor der er arbeitet. Packt Ananas, Kochbananen und Kartoffeln in Plastiktüten, schleppt die prallen Tüten auf den Parkplatz, lädt ein. Schließt den Kofferraum, wünscht alles Gute, winkt das nächste Auto heran. Schon von Weitem ist er in seiner orangenen Warnweste zu sehen.
Leben von den Trinkgeldern der Kunden
Vor vier Jahren kam der 53-jährige Venezolaner nach Quito. 23 Tage brauchte er für die Strecke vom heimischen Guajíra, an der Grenze zu Kolumbien, über Cúcuta weiter südlich bis nach Ecuador. Das meiste davon lief er zu Fuß, fast ohne Gepäck, nur mit den Kleidern, die er anhatte. Mit Unterstützung der jüdischen Hilfsorganisation HIAS und der Caritas fand er nach seiner Ankunft in Quito das Notwendigste zum Überleben. Eine Zeitlang verkaufte er, wie so viele venezolanische Flüchtlinge, Bonbons auf der Straße, immer an derselben Kreuzung; darüber lernten ihn die Bewohner des Viertels kennen. Seit zweieinhalb Jahren betreut er die Einkaufenden in dieser Straße, ist er regelmäßig auf dem winzigen Parkplatz vor dem Obstladen zu finden. Die Besitzer der Frutería freuen sich über sein Engagement. Im kleinen Supermarkt gegenüber darf er seinen Rucksack unterstellen. Leben tut der große Mann mit grauem Bürstenhaarschnitt von den Trinkgeldern der Kunden.

Sechzig Prozent der ecuadorianischen Bevölkerung verdienen ihr Geld ähnlich wie Edison: als „informales“, ohne feste Anstellung, Versicherung und geregelte Arbeitszeiten. „Wenn es regnet, geht niemand einkaufen, dann ist der Tag für mich gelaufen.“ Zum Glück regnet es in Quito selten einen ganzen Tag lang. Aber Edison hat noch ganz andere Probleme: Seine Frau, die ausgebildete Krankenschwester ist, leidet an einer Herzkrankheit. Immer wieder muss sie zu Untersuchungen und Behandlungen ins Krankenhaus. „Das alles ist sehr kostspielig, und ich kann an solchen Tagen nicht arbeiten.“ Außerdem besuchen zwei seiner drei Kinder noch die Schule, auch die kostet Geld. Die älteste Tochter hat mit zwei kleinen Enkeln Ecuador mittlerweile wieder verlassen, auf dem hier bekannten und gefährlichen Weg Richtung USA, wo sie nun “mehr schlecht als recht” in der Nähe von New York lebt.
Endlich regelt die ecuadorianische Regierung den Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge
Stolz zeigt mir Edison sein frisch erworbenes „certificado migratorio“, eine von den ecuadorianischen Behörden ausgegebene Karte, mit der er nachweist, dass er seit März dieses Jahres als Flüchtling offiziell registriert ist. Seit Beginn der Krise in Venezuela sind rund 1,8 Millionen Venezolaner nach Ecuador gekommen. Damit ist Ecuador nach Kolumbien und Peru das drittgrößte Aufnahmeland in der Region. 73% der Geflüchteten kamen irregulär, ohne Registrierung oder Papiere, über die grüne Grenze zu Kolumbien ins Land. Viele von ihnen sind bereits in andere Staaten Lateinamerikas oder die USA weitergezogen. Die “International Organisation for Migration” IOM rechnet mit rund 450.000 Flüchtlingen, die sich aktuell noch in Ecuador befinden. Aber erst vor einem Jahr entschloss sich die hiesige Regierung auf Drängen der internationalen Gemeinschaft und zahlreicher Hilfsorganisationen, die Regelung des Aufenthaltsstatus’ aller Flüchtlinge anzugehen. Nach Daten des Netzwerks Relief Web vom 27. Juni dieses Jahres haben mittlerweile 158.000 Venezolaner das certificado migratorio erhalten, das ihnen die Beantragung eines Visums für zunächst zwei Jahre gestattet. Dieses Visum haben bisher 66.000 venezolanische Staatsbürger erhalten. Internationale Beobachter sind zufrieden mit dem Verlauf des Prozesses, der sich zurzeit recht dynamisch entwickelt.
Die hiesige Gesellschaft tut sich mit der Akzeptanz der Flüchtlinge schwer
Für viele der Geflüchteten ist diese Entwicklung grundsätzlich positiv, verbinden sie damit doch die Hoffnung, im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten des ecuadorianischen Arbeitsmarkts legal arbeiten zu können. Allerdings stellt schon die Visumsgebühr von 50$ für viele der Migranten eine hohe Hürde dar. Und bis zu ihrer Akzeptierung durch die ecuadorianische Gesellschaft ist es noch ein weiter Schritt. Ecuadorianer und Venezolaner waren sich schon vor der Flüchtlingskrise nicht besonders nahe, und unfreundliche Kommentare gegenüber „diesen Flüchtlingen, die entweder auf den Straßen betteln oder uns die Arbeit wegnehmen“ sind hierzulande in allen Schichten gesellschaftsfähig. Eine Bekannte berichtet von einer begabten venezolanischen Schülerin, der als Jahrgangsbester an ihrer staatlichen ecuadorianischen Schule das Halten der Abiturrede verweigert wurde, denn „sie sei ja nicht von hier“. Die von Nachbarn bei einem Bier gerne geäußerte Vermutung, die jungen venezolanischen Männer seien überproportional häufig in Drogen- und sonstige Delikte verwickelt, lässt sich statistisch nicht belegen.
Immer wieder überrascht die Energie, mit der die geflüchteten Männer und Frauen ihr Schicksal trotz aller Widrigkeiten selbst in die Hand nehmen. Die junge Kellnerin in der Pizzeria, die nach monatelangem Suchen endlich eine Schule für ihren behinderten Sohn gefunden hat. Der fünfundzwanzigjährige Mechaniker, der mit seinen vier Brüdern von einer eigenen Motorradwerkstatt träumt und sich auf dem Weg dahin durch nichts aufhalten lässt. Und ein Mann wie Edison, der zum Abschluss unseres Gesprächs einfach sagt: „Wissen Sie, ich wollte Sie auch schon lange ansprechen, aber ich traute mich nicht. Danke, dass Sie mir zugehört haben!“.
30. Juni 2023