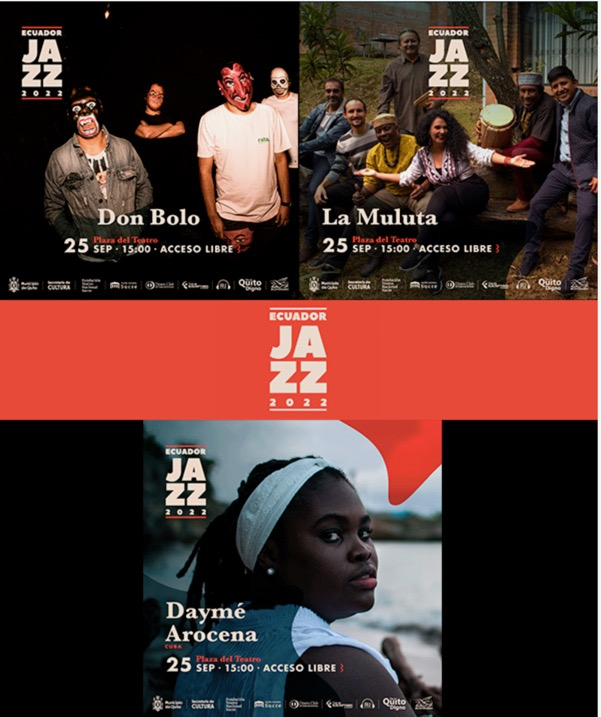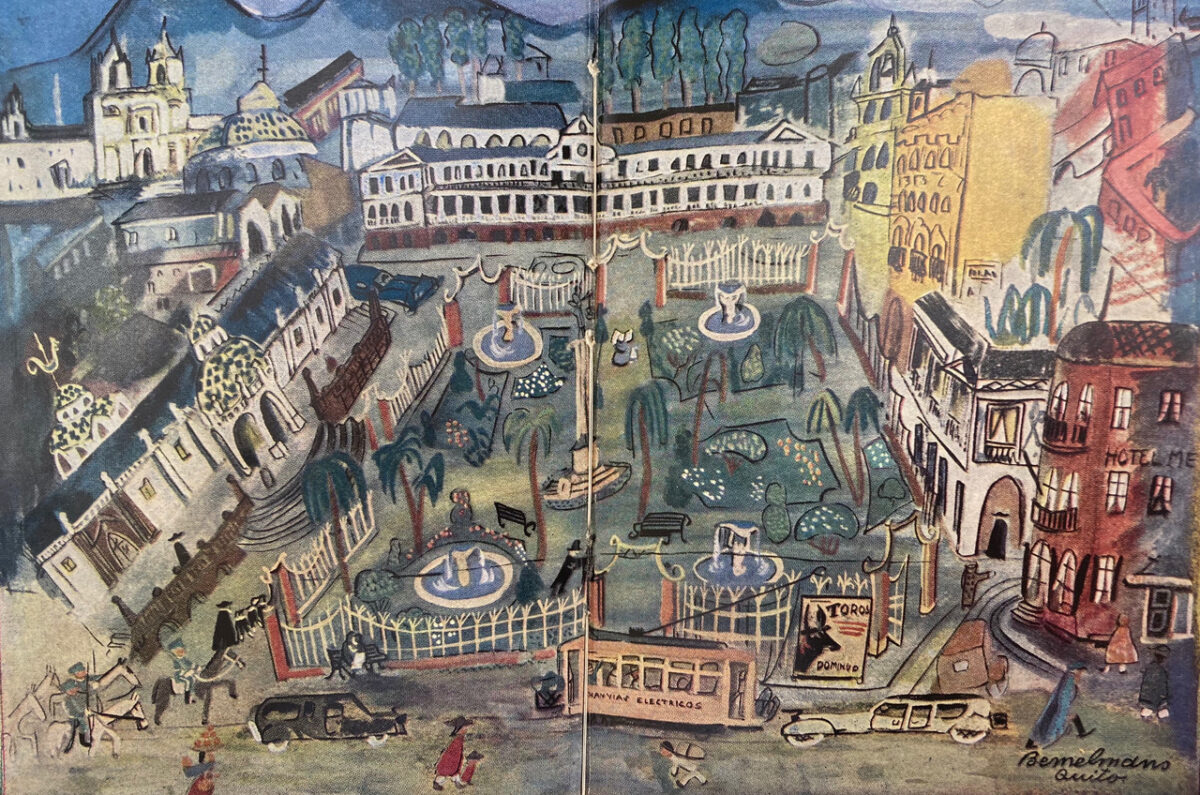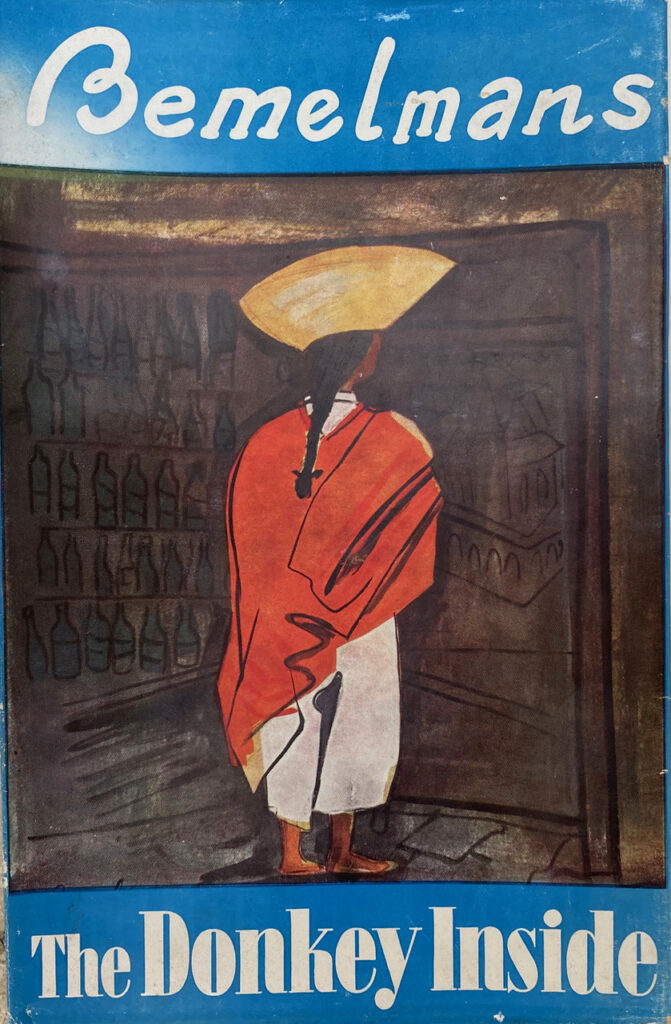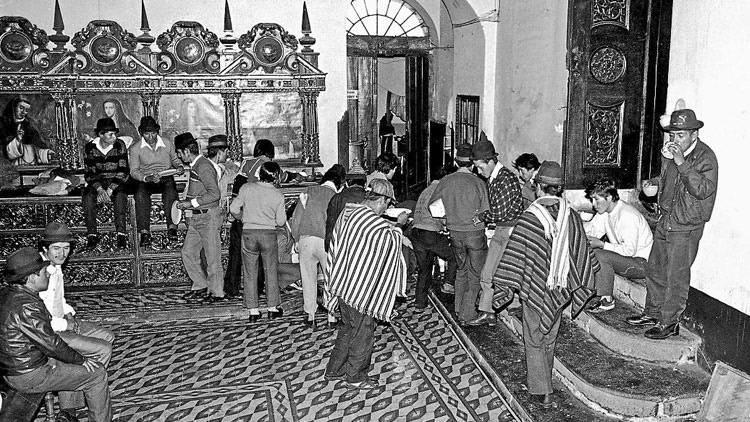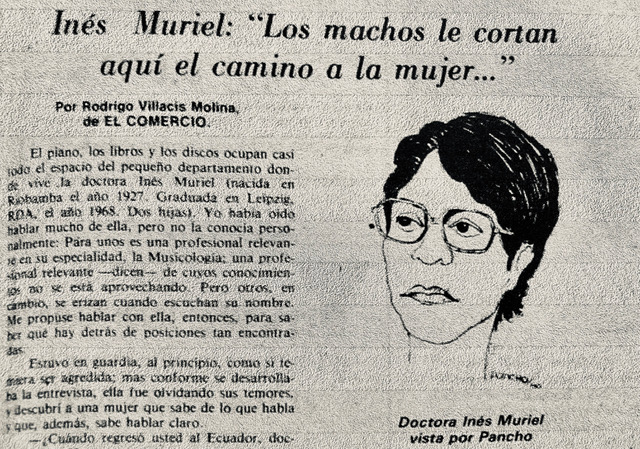Zwei Frauen sitzen in Tumbaco bei Quito an einem großen Glastisch und sortieren Vanille. Der betörende Duft der braunen Schoten erfüllt den ganzen großen Raum. Neben sich haben die Arbeiterinnen ein Lineal liegen, das sie eigentlich nicht mehr brauchen. Sie wissen aus Erfahrung genau, welche Schotengröße in welche der drei schwarzen Plastikwannen gehört. Je eine für die großen, mittleren und kleinen Vanillestangen. Rund sechzig Prozent der Ernte machen die besonders langen und dicken Exemplare aus, die beim Verkauf den besten Preis erzielen.
Vor 20 Jahren begann Eduardo Uzcátegui in der Provinz Santo Domingo de los Tsachilas, rund zwei Autostunden westlich der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, mit dem gezielten Anbau der zur Familie der Orchideen zählenden Vanille. Zunächst nur aus Neugier, wie er erzählt: „Ein Belgier hatte versucht, sie hier zu züchten, aber das funktionierte irgendwie nicht. Als er das Land etwas frustriert wieder verließ, schenkte er mir eine Pflanze. Ich bin zwar selbst Biologe, hatte mich aber eigentlich immer mehr mit Tieren beschäftigt, insbesondere mit der Zucht von Wachteln, seit 26 Jahren habe ich da ein Unternehmen. Aber dann wollte ich sehen, ob das mit der Vanille nicht doch geht!“
Pro Hektar Anbaufläche ist die Produktion in Ecuador größer als in Madagaskar und Indonesien
Nach fünf ersten erfolgreichen Jahren erlitt aber auch seine eigene Vanilleproduktion einen herben Rückschlag. Das feuchte Tropenklima von Santo Domingo ließ nicht nur die Pflanzen wachsen, sondern begünstigte auch alle Arten von Schädlingen. Erst als Uzcátegui begann, die Vanille im Gewächshaus zu züchten, wo sich Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Schädlinge besser kontrollieren ließen, hatte er dauerhaft Erfolg: Seine Vanillepflanzen trugen bereits nach zwei Jahren das erste Mal die begehrten grünen Schoten. Nur zwei Hektar ist die Plantage seiner Firma „VAINUZ“ heute groß, aber der Ertrag ist eindrucksvoll: Auf jedem Hektar stehen 10.000 Pflanzen, die im Jahr etwa 1000 kg frischer Vanille liefern. In Indonesien, dem zweitgrößten Exportland nach Madagaskar, sind es nur 400 kg pro Hektar.
Das „grüne Gold“ hat in Ecuador, wo mehrere wild wachsende Vanillesorten vorkommen, in den letzten Jahren einen großen Aufschwung genommen. Nicht nur in Santo Domingo wird die Pflanze angebaut, auch am Napo-Fluss im östlichen Tiefland und in der Provinz Manabí am Meer gibt es immer mehr meist kleine Produzenten. Denn Ecuador ist privilegiert: Die Zahl der Sonnenstunden am Äquator ist über das Jahr im Vergleich zu anderen Ländern wie Mexico, dem Ursprungsland der Vanille, oder Madagaskar, äußerst stabil. Das erlaubt auch bei anderen landwirtschaftlichen Produkten mehrere Ernten im Jahr; beim Brokkoli beispielsweise sind es bis zu vier. Ein großer Wettbewerbsvorteil für die hiesigen Exporteure. Während es in anderen Anbauländern für die Vanille nur eine einzige jährliche Reifeperiode gibt, kann die kostbare Ware hier das ganze Jahr hindurch geerntet werden.
Die Bestäubung der Blüten ist Frauensache
Dieser paradiesische Zustand verursacht allerdings ein unerwartetes Problem: Von außen lässt sich kaum erkennen, welche der wie grüne Bohnen anmutenden Vanilleschoten bereits reif sind. Nur mit Hilfe eines detaillierten Kalenders kann sichergestellt werden, dass die Ernte jeweils zur richtigen Zeit erfolgt. Eine andere Herausforderung teilen alle Vanilleproduzenten weltweit: Das systematische Bestäuben der Blüten ist ausschließlich von Hand möglich, und nur in den Vormittagsstunden eines jeden Tages. Dafür beschäftigen VAINUZ und andere in Ecuador produzierende Unternehmen ausschließlich weibliche Angestellte. „Frauen arbeiten viel sorgfältiger und haben eine bessere Feinmotorik; wenn wir Männer das machten, würden wir die empfindlichen Blüten der Orchidee zerstören, und ein Großteil der Pflanzen würde wahrscheinlich niemals tragen“, schmunzelt Uzcátegui.

Der Ernte folgt in der Regel ein rund zweieinhalb Monate dauernder Prozess von Reinigung, Fermentierung und Trocknen der Schoten, zunächst in der Sonne, dann im Schatten. Wenn Uzcáteguis Vanille nur noch 18% ihres ursprünglichen Feuchtigkeitsgehalts besitzt, reist sie von Santo Domingo nach Tumbaco. Dort wohnt der Unternehmer, der zweiundzwanzig Jahre lang Dekan der landwirtschaftlichen Fakultät an der „Universidad San Francisco de Quito“ (USFQ) war. „Das Sortieren und Verpacken haben wir früher noch an meinem Küchentisch gemacht, bis ich dann auf meinem Grundstück gegenüber diese neue Halle hier gebaut habe“.
Vom wertvollen „Kaviar“ bis zum schlichten Vanilleextrakt
Nach dem Sortieren am Glastisch werden die Schoten in dicken Kilopaketen verpackt. Für den schnellen Verbrauch in der Gastronomie wird nur das Mark der Vanille, der „Kaviar“, benötigt. Wie Goldbarren liegen die Pakete, die jeweils ein Pfund wiegen, im hölzernen Regal. Über 500$ war ein solches Päckchen vor der Pandemie wert, im Moment ist es weniger. Geradezu obszön wirken daneben die großen Vier-Liter-Plastikflaschen mit dem preiswerten Vanilleextrakt, einem Abfallprodukt, das für den Export nach Kanada bestimmt ist. 90% seiner Vanille liefert Uzcátegui nach Europa, Nordamerika, Japan und Hawaii. Nur ein kleiner Teil verbleibt im Land. Anders als die von ihm weiterhin vermarkteten Wachteln: Zwei Millionen der winzigen Vögel verkauft der emeritierte Professor jährlich an Restaurants in Ecuador, tiefgefroren in Paketen zu je zehn Stück. Eine Kreuzung aus einer kleinen japanischen und einer größeren deutschen Art hat sich dabei als besonders erfolgreich erwiesen. Die kleinen, hübsch gefleckten Wachteleier, die man hier in jedem noch so winzigen Supermarkt bekommt, sind nicht nur bei Schulkindern ein beliebter und vergleichsweise preiswerter Snack.
Was den Wachteln recht ist, ist der Vanille billig
Wachteln und Vanille – selbst im instabilen Ecuador, wo man möglichst immer mehrere Geschäfte gleichzeitig führen muss, um gegen jede Wirtschaftskrise gewappnet zu sein, erscheint eine solche Verbindung überraschend. „Es gibt aber tatsächlich Parallelen! Wir haben vor einiger Zeit begonnen, mit unseren eigentlich für die Wachteleier gebauten Brutschränken zu experimentieren, um sie als Trockenschränke für die Vanille zu weiterzuentwickeln. Jetzt können wir in einem solchen Schrank 100 kg Vanille in viel kürzerer Zeit als zuvor verarbeiten!“ Vielleicht ist es auch einfach nur die stete Neugier eines begeisterten Biologen und Tüftlers, die Zusammenhänge schafft, wo vorher keine waren. Im Laden in Tumbaco jedenfalls können beide Delikatessen zugleich mit einem einzigen Einkauf erworben werden.
Verkauf von Vanille und Wachteln in Tumbaco (auch in küchentauglichen Mengen): VAINUZ, Gonzalo Pizarro #N5-683/ Machala, Öffnungszeiten Mo-Fr von 8-12 und 14-18 Uhr. Cel. 0998 374 783, 0995 656 016, E-mail vainuzecuador@hotmail.com
5. November 2022