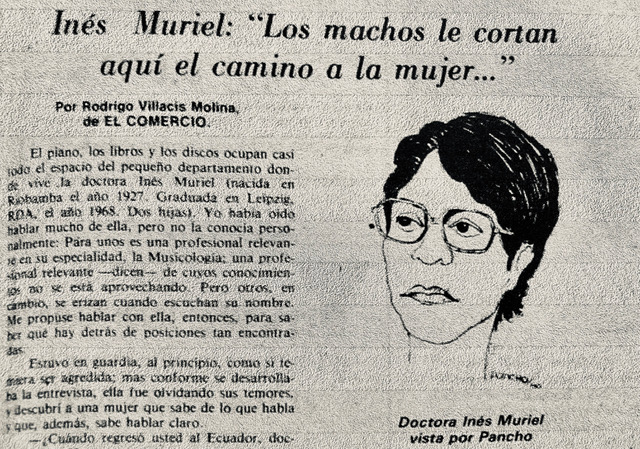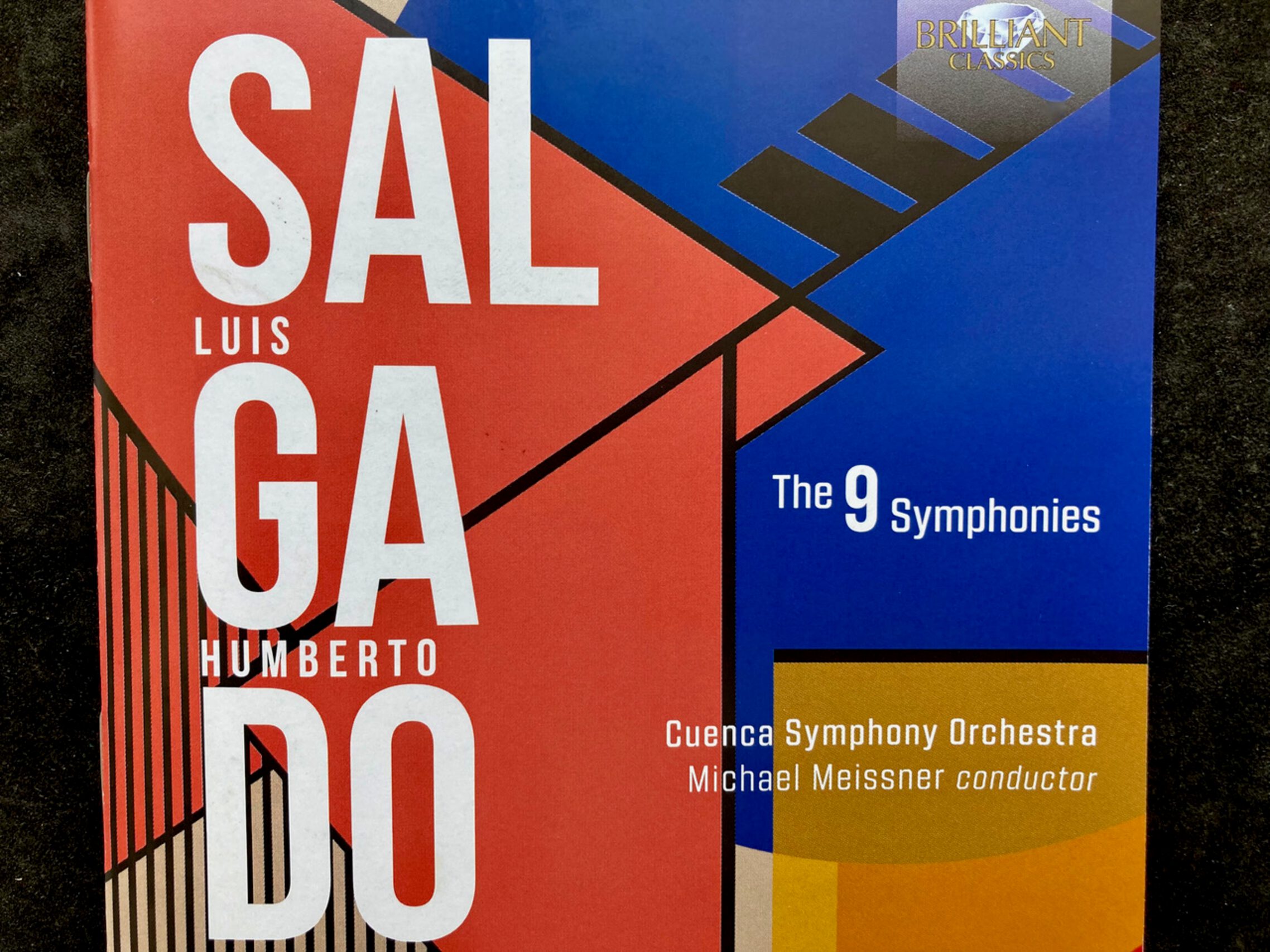Die Flügelspitzen von Copiopteryx semiramis gleichen langen Frackschößen. Die handtellergroße Motte sitzt auf dem Arm von Mathieu de Goulaine, und der Franzose ist begeistert: „Das ist ein befruchtetes Weibchen; es lebt nur wenige Tage, und seine einzige Aufgabe ist es, in diesen Tagen seine Eier abzulegen. Wenn ich schnell die richtige Wirtspflanze herausfinde, kann ich auch diese Art züchten, das wäre wunderbar!“ In Zeiten des Internets antworten die Schmetterlingsfreunde aus aller Welt schnell auf die Frage „was frisst Copiopteryx“. Und die Lieblingsnahrung des Tieres findet sich tatsächlich in einem der weitläufigen Gewächshäuser der Quinta de Goulaine.
Seit 2015 züchtet Mathieu de Goulaine Schmetterlinge im ecuadorianischen Regenwald, etwa eine Stunde entfernt von dem beliebten Touristenort Mindo. Auf einer Höhe von 450m über dem Meeresspiegel hat er 50 Hektar Land gekauft, die zum größten Teil noch aus Primärwald bestehen. Eine Seltenheit in dieser Gegend. Anfang der 1980-er Jahre wollte die damalige ecuadorianische Regierung die Region besiedeln und vergab das Land an Interessenten. Unter der Bedingung, dass diese mindestens die Hälfte der Fläche abholzten und dort Viehzucht betrieben. „Aber das war Wahnsinn, hier ernährt ein Hektar Land nur eine einzige Kuh, und durch den Einsatz von Pestiziden gerät das gesamte ökologische Gleichgewicht durcheinander.“
Mehr Schmetterlingsarten auf 50 Hektar als in ganz Europa
Der Regenwald hier ist ein Paradies. 350 Arten von Tagfaltern, also tagaktiven Schmetterlingen, leben hier – in ganz Europa sind es nur 250. Rund vierzig Arten fliegen durch die drei weitläufigen Volieren auf der Quinta de Goulaine. Es riecht penetrant nach überreifen Bananen, einer Leibspeise vieler Falter. Überall stehen Behälter mit einer Mischung aus Zuckerwasser und Sojasauce, Energietrunk für die Schmetterlinge. Die Angestellten sammeln die auf den Blättern abgelegten winzigen Eier ein, desinfizieren und prüfen sie.
Die für gut befundenen Eier jeweils einer Art wandern gemeinsam mit einer passenden Wirtspflanze in ein geschlossenes Netz, das einem weißen Kleidersack ähnelt. Dort schlüpfen nach 7-10 Tagen die Raupen. Schmetterlingsraupen sind wählerisch: Manche Arten ernähren sich nur von einer einzigen Pflanze und würden eher sterben, als auf anderes Futter auszuweichen. Es müssen also immer ausreichend Futterpflanzen der richtigen Art zur Verfügung stehen – für den Züchter eine logistische Herausforderung.
Damit die Schmetterlinge nicht zu früh schlüpfen, werden die Puppen im Weinkeller kühl gehalten
Mit der Verpuppung der Raupen naht ihr Abschied von der Quinta. Ab Februar öffnen in Europa die beliebten Schmetterlingsgärten für den Publikumsverkehr. Dann bringt Mathieu de Goulaine wöchentlich 1.500 bis 2.000 Puppen, sorgfältig in Styroporkästen verpackt, zum Flughafen nach Quito. „Wenn ich Angst habe, dass einige Schmetterlinge zu früh schlüpfen, lagere ich die Puppen im kühlen Weinkeller; damit gewinne ich ein bisschen Zeit“. Mit Wein hat de Goulaine Erfahrung: Das südlich von Nantes gelegene Château de Goulaine ist eines der bekannten Weingüter Frankreichs; Mathieus Vater, Robert de Goulaine, errichtete dort bereits 1984 eine Voliere für Schmetterlinge.
Der Wein ist auch das Bindeglied zu dem zweiten Geschäftszweig der Quinta: dem Kakao. Zwischen den Futterpflanzen für die Schmetterlinge sind in den letzten Jahren zahlreiche Kakaopflanzen der endemischen Sorte „Nacional – Fino de Aroma“, auch „Arriba“ genannt, angebaut worden. „Mein Traum ist es, dass Kakao demnächst wie Wein nach bestimmten Lagen klassifiziert wird. Dann würde nicht nur die Verarbeitung, sondern auch die Herkunft der Kakaobohne bei der Bewertung berücksichtigt.“ Ein einfacher Produzent erhält in dieser Gegend zur Zeit 3,20 US-Dollar pro Kilo fermentierter Kakaobohnen.
Pflanzenvielfalt bedeutet Schmetterlingsvielfalt – und Lebensraum für den Menschen
Alles ist miteinander verbunden: Während unserer mehrstündigen Wanderung durch den dichten, vor Feuchtigkeit dampfenden Wald bleibt Mathieu de Goulaine immer wieder stehen und erklärt. „Dies ist die Futterpflanze des Diaethria clymena, der wegen der Zeichnung auf seinen Flügeln den Spitznamen 89/98 trägt. Und schauen Sie, hier, diese Pflanze, die halb Farn, halb Flechte ist, ist typisch für den Primärwald! Eigentlich müssten wir nur die Pflanzenvielfalt hier erhalten, dann bleiben auch die Schmetterlinge.“ Offenbar schätzte schon das präinkaische Volk der Yumbo die Vielfalt des Waldes. Die Yumbo verfügten in der Gegend über mehrere Siedlungsstätten; es wird vermutet, dass sie auch die Mauer errichteten, an der sich unser Pfad entlangschlängelt.
Aber es ist nicht nur die Begeisterung für Schmetterlinge, Kakao und Wald, die unseren Aufenthalt zum Erlebnis werden lässt. Da sind noch die zwei netten Gästezimmer, das Bad im Fluss, der Apéro am offenen Feuer und das gute Essen, mit Mathieu und seiner ecuadorianischen Frau Janneth am Familientisch in der Küche eingenommen. Draußen singt ein Frosch, einem Vogel gleich. Und dann kommt Copiopteryx.
Quinta de Goulaine: Von Quito mit dem Auto in drei bis dreienhalb Stunden zu erreichen. Anfahrt möglichst mit einem geländegängigen Fahrzeug: www.quintadegoulaine.com
26. November 2021