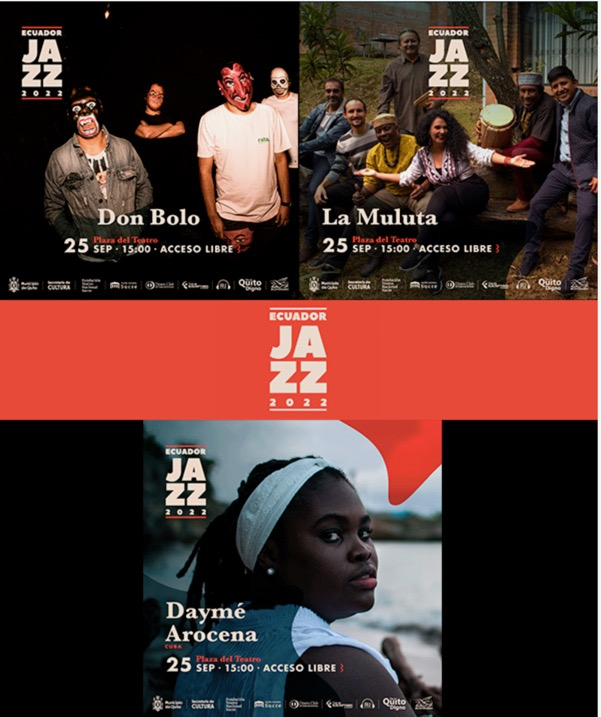Blutrot leuchten die Lettern von den Plakaten: „RESIST!“ Das Tonhain-Kollektiv eröffnet an seinem Sitz in Steglitz die Saison mit einer neuen Konzertreihe, die sich der Frage widmet: Wie klingt Widerstand?
„Soundtrack of the Resistance“ ist auch der Titel des Auftaktkonzerts in der mittlerweile in vollem Glanz erstrahlenden Location. Initiator und Geschäftsführer Benjamin Lai hat eben noch mit dem Scanner in der Hand das Publikum in Empfang genommen. Nun steht er inmitten der um Notenpulte und Klavier gruppierten Zuhörerschaft, 99 Stühle oder ein paar mehr, und freut sich, dass wieder einmal jeder Platz besetzt ist.
„Angesichts des beunruhigenden Anstiegs von Autoritarismus, politischer Polarisierung und Isolationismus sehen wir es als unsere PFLICHT als Künstler, darauf zu reagieren“, heißt es, fast protestantisch, auf der Website des Kollektivs. Benjamin Lai drückt es etwas schlichter aus: „Wir wollen klassische Kammermusik relevant machen, sie mit Themen unserer Zeit verbinden“.
Wie also hört sich das an, Widerstand? Alle Werke dieses Abends entstanden innerhalb von nur wenigen, durch Diktatur und Krieg geprägten Jahren zwischen 1937 und 1942. Arnold Schönbergs „Ode to Napoleon Buonaparte“, das dritte Streichquartett des Tschechen Pavel Haas, und Dmitri Schostakowitschs Klavierquintett verkörpern für die Musiker drei Formen der Opposition gegen ein Regime: direkt und öffentlich bei Schönberg; als Beharren auf nationaler und künstlerischer Eigenständigkeit bei Haas; und durch indirekte Anspielungen und „Ambivalenzen“ (Benjamin Lai) bei Schostakowitsch.
Arnold Schönbergs „Ode to Napoleon Buonaparte“ ist zurzeit häufiger auf Konzertprogrammen zu finden. Dabei ging es dem im Exil in den USA lebenden Komponisten im Jahr 1942 nicht um Napoleon. Den Text, eine flammende Anklage, verfasste der britische Dichter Lord Byron anlässlich der Abdankung des Kaisers der Franzosen 1814; Schönberg aber schrieb, mitten im Zweiten Weltkrieg, für das Publikum seiner Zeit. Und wir hören Worte und Musik mit unseren heutigen Ohren: „Ist das der Herr von tausend Reichen, der alle Welt besät mit Leichen? Und mag er’s überleben?“, fragt Sprecher-Sänger Andrew Munn (Bass) sein Gegenüber, die vier Streichinstrumente und das Klavier (Marcel Mok). „Nein“, antworten diese. Wie der Chor einer griechischen Tragödie reagieren die Instrumente auf das Gesagte, hinterfragen, wimmern und kommentieren, mit Klängen von schneidenden Schwertern, Marschieren und Pferdegetrappel. Oder auch einmal mit Schweigen. Munn scheint die Figur des auf ein Nichts reduzierten Herrschers buchstäblich in seiner Hand zu halten – mal verächtlich, mal staatstragend spricht er ihn an. Das Ganze hat einen Drive, dem man sich nicht entziehen kann, bis zum ironischen Schlussakkord.
Leiseres Drama im zweiten Stück: Pulsierend beginnt es in der Bratsche (sehr präsent: Seo Hyeun Lee), bevor die anderen Mitglieder des Quartetts (Georgii Moroz und Benjamin Günst, Violine; Yehjin Chun, Cello) in die Unterhaltung eingreifen. Pavel Haas vollendete das letzte seiner Streichquartette 1938, im Jahr des Münchner Abkommens, das die Annexion des Sudetenlands durch das Deutsche Reich ermöglichte. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde er 1941 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo er weiter komponierte und Stücke zur Aufführung brachte; 1944 wurde er in Auschwitz ermordet. Vieles in Haas‘ Musik erinnert an seinen Lehrer Leoš Janáček: der sprechende Tonfall, die Klangfarben. Wie dieser greift Haas mit Rhythmen und Harmonien auch die Volksmusiktradition seines Landes auf – als Teil seiner musikalischen Identität oder als Statement. War der Klang der Streicher, inspiriert durch das Klavier, bei Schönberg oft perkussiv, wird er jetzt allmählich transparenter, wärmer. Die vier Musiker sind ein Organismus, zusammengehalten durch Klang, gemeinsames Atmen, Blicke, Gesten. Und in diesem überschaubaren Raum – nicht Kammer, aber eben auch nicht wirklich Saal – werden die Zuhörer direkt Teil des Geschehens, vibriert die Luft – totale Immersion, die einen klanglich ziemlich umhaut.
In der Pause heißt es dann erst einmal: Spannung raus. Da sind die Musiker an der Bar und schenken Getränke aus, während das Publikum aller Altersklassen plaudernd auf der Straße, im Innenhof und zwischen den Stühlen steht. Unter den Gesprächspartnern viele, die schon in der letzten Saison dabei waren: Musikliebhaber aus ganz Berlin, Kollegen der Musiker, aber auch so mancher Kiezbewohner, angeworben von Freunden und angezogen durch „Musik, die man sonst nicht so oft hören kann“.
Und dann Schostakowitsch. Dessen gerne gespieltes Klavierquintett war im Ergebnis eine der vielen Rehabilitierungsmaßnahmen des 1936 bei der politischen Führung in Ungnade gefallene Komponisten. Das Stück wurde bei seiner Uraufführung 1940 vom Moskauer Publikum begeistert aufgenommen; Schostakowitsch selbst erhielt dafür 1941 den Stalin-Preis erster Klasse. Das eingängige Quintett, für das Benjamin Günst und Georgii Moroz die Rollen getauscht haben, kommt in Form und Harmonik ganz (neo-)klassisch daher. Besonders in der Fuge, und später auch im Intermezzo, zieht uns die von den Musikern schwebend und transparent gestaltete intime Atmosphäre der Musik in ihren Bann, auf einmal sind wir in einer anderen Welt. Aber unheimliche Schritte im Klavier stellen bald klar, dass dies nur eine trügerische Ruhe ist. Alles nur ein Scherz – oder das Wissen darum, dass im Leben nichts gewiss ist?
Viel Begeisterung und strahlende Gesichter beim Schlussapplaus. Rote Rosen überreicht ein Freund des Ensembles. Man darf gespannt sein, wie die energiegeladenen jungen Musiker des Tonhain-Kollektivs den Faden weiterspinnen. Von William Byrd über Amy Beach bis zu Jimi Hendrix‘ ikonischer Version des „Star Spangled Banner“ reicht das Programm der nächsten Monate. Eines ist sicher: Langweilig wird es nicht werden.
Anmerkung: Dieser Text ist zuerst am 27.09.2025 in den Stadtrand-Nachrichten erschienen.