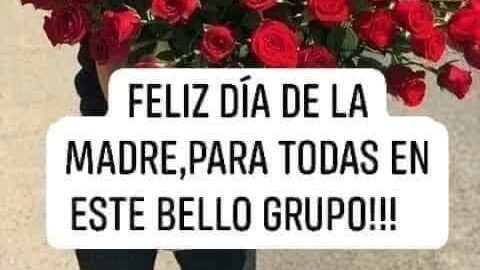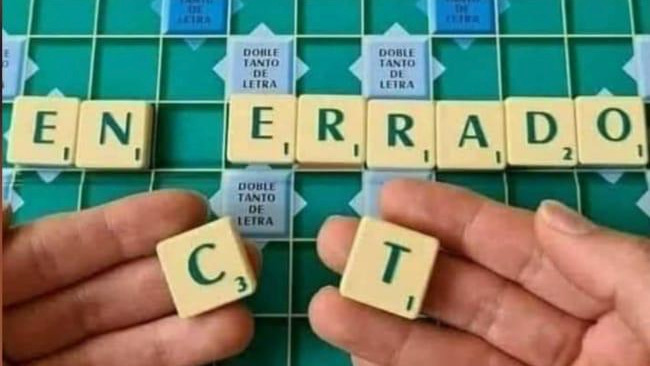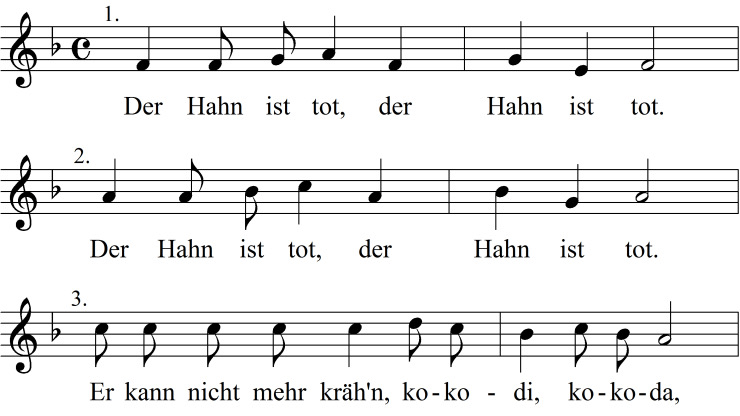Ein erster virtueller Blumenstrauß beim Aufwachen: „Feliz Día de la Madre!“ WhatsApp ist zum festen Bestandteil unseres Lebens geworden. Oder nein: Es ist das Leben. Brot oder indisches Essen bestellen, Friseurtermin reservieren, die Katze in der Tierklinik anmelden – längst Gewohnheit. Im Archiv des Außenministeriums nachfragen, ob die gesuchte Akte zu einer in den Sechziger Jahren ins Ausland emigrierten Wissenschaftlerin gefunden wurde – nur über den direkten Kontakt zum Handy der Archivarin. Vor einigen Monaten wollte ich für unsere lokale Hilfsorganisation einen Termin mit einer Kirchengemeinde im Süden Quitos vereinbaren und erhielt binnen kurzem eine WhatsApp-Nachricht des Erzbischofs persönlich: Ob ich bitte rasch einmal anrufen könne?
Am heutigen Muttertag gibt das Smartphone gar keine Ruhe. In allen Chatgruppen strömen sie herein, die Bouquets, Gedichte, Grußkarten und Glückwünsche. Der Reitstall gratuliert ebenso wie die Schule, die Gemeinde, die Kollegen, die Nachbarn. Gewiss, auch am Tag des Lehrers und dem des Kindes ist viel Bewegung auf dem Handy, aber der Tag der Mutter, das ist in Ecuador eine Ikone. Ein Tag, der alle angeht, der die Herzen höher schlagen und die Familien zusammenkommen lässt. Der in normalen Jahren den Einzelhandel glücklich macht und die Restaurants zum Bersten füllt.
Ohne Mariachi kein Muttertag, auch nicht in der Pandemie
Nicht so in diesen Tagen, in denen am Wochenende in sechzehn Provinzen des Landes strenge Ausgangssperre herrscht. Muttertagstechnisch ein Desaster. Keine Besuche bei der Familie, es sei denn, man hat schon am Freitag Abend Mutter, Ehemann, Kinder und Cousins samt den benötigten Lebensmitteln und Alkoholika in den Pick-up gepackt und ist auf die Hacienda gefahren. Geplante Rückkehr in die Stadt am Montagmorgen. Aber halt, ein Zugeständnis gibt es, vom nationalen Notstandskomitee in letzter Minute gewährt: Die traditionell zum Muttertag angeheuerten Sängergruppen der „Mariachi“ dürfen auch in diesem Jahr den Müttern zu Ehren ihre Ständchen bringen, solange sie auf der Straße bleiben und nicht länger als dreißig Minuten vor dem Haus verweilen. Ein Besuch auf der zentralen Website, eine Nachricht an die dort genannte Nummer, und schon ist der musikalische Gruß an die Mutter in Auftrag gegeben.
Blumen darf man ebenfalls per App nach Hause ordern, ausnahmsweise an diesem Sonntag. Und das Restaurant um die Ecke liefert, irgendwie, wir sprechen mal nicht darüber. Die Nummer der Eigentümerin, wo war die noch…? Die Tageszeitung macht reich bebildert auf mit „Fünf Mütter, fünf Leben“, und kündigt zur Feier des Tages eine vierseitige Sonderbeilage an. Direkt darunter, als wäre es Werbung für lokales Kunsthandwerk, ein nur unwesentlich kleinerer Text: „Spezialisten für Särge und Urnen haben in der Pandemie besonders viel Arbeit“. Diese dumme Realität, die einem immer nur für eine halbe Seite die Feiertagslaune gönnt.
Das größte Geschenk an die Mutter: die Impfung
In Kenntnis dieser Realität versuchten sich manche Ecuadorianer an einem den Umständen angemessenen Geschenk für die Mutter: dem Ergattern einer COVID-Impfung. Die staatliche Sozialversicherung IESS hatte vor wenigen Tagen angekündigt, dass nunmehr alle Bürger über 65 Jahre einen Termin in den sogenannten Impfzentren reservieren könnten. Da das mit dem Reservieren online oder per Telefon aber oft nicht so recht klappen will, nahmen viele Söhne und Töchter die Dinge entschlossen selbst in die Hand: „Ich werde am Samstag mit meiner Mutter losgehen und schauen, dass sie die Impfung bekommt, egal wie“, verkündete eine Bekannte vor wenigen Tagen. Am 4. Mai sind angeblich 100.000 Dosen Biontech am Flughafen in Quito angekommen, also neues Spiel, neues Glück. Und irgendjemand sagte doch etwas von einer halben Million Dosen Sinovac? Aktuelle Info liefert der Chat mit Freunden und Bekannten.
Wer nicht stundenlang in Sonne und strömendem Regen anstehen will und über das nötige Kleingeld verfügt, wählt die bequeme Variante: Den Flug in die USA. Eine vollkommen rationale Entscheidung: Da die Kosten einer hiesigen Krankenhausbehandlung trotz Versicherung schnell in die Zehntausende von Dollar gehen, scheint ein Flug nach Miami oder Atlanta auch ökonomisch die sinnvollste Lösung. Die Partygespräche (nein, natürlich keine Parties, nur Treffen im Garten unter strengster Einhaltung der Abstandsregeln) dieser Tage sind voll davon: „Wir sind in Florida einfach von Ort zu Ort gefahren, um zu gucken, wo wir drankommen. Die Kinder in der einen Stadt, mein Mann und ich im Nachbarort. Das war schon Arbeit, und es dauerte lange, aber schließlich hat es geklappt.“
Ein Leben ohne WhatsApp? Nicht denkbar in Ecuador
Koordinierung des familiären Impftermins über die interne WhatsApp-Gruppe, selbstverständlich. Mal so eben so zu einem anderen Anbieter wechseln? Gar ganz darauf verzichten? „Ohne Sinn“, würde unser Siebzehnjähriger dazu sagen. Datenschutz ist eine amüsante Idee in einem Land, in dem man nur die zehnstellige Personalausweisnummer eines Bekannten googeln muss, um beinahe alles über dessen Leben zu erfahren. In einer Zeit, in der man alle Regierungsbeamten im Homeoffice ausschließlich über die grüne App erreicht. Welcher befreundeten Mutter wollte ich noch Blumen schicken? Nie war es einfacher als heute.
Sonntag, 09. Mai 2021